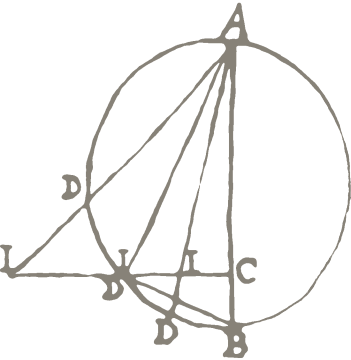Der Blick auf die heutige Wissenschaft offenbart einen seltsamen Widerspruch: Während Wissenschaft und ihre Erkenntnisse noch nie wichtiger waren als heute, wird ihnen gleichzeitig mehr Misstrauen als jemals zuvor entgegengebracht. Die Ursprünge dieses Misstrauens sind vielschichtig. In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Momente offenbar, in denen Wissenschaftler*innen in stillschweigendem Einverständnis mit der Industrie und der Regierung ihre eigenen Interessen über das Wohlergehen der Gesellschaft gestellt haben. Gleichzeitig haben sich Wissenschaftler*innen zunehmend zu strukturellen Problemen geäußert, die nur durch einschneidende Veränderungen in Lebensgewohnheiten gelöst werden können. Kritiker*innen dieser Veränderungen zögerten nicht, die Beweggründe und Methoden der Wissenschaftler*innen in Frage zu stellen. Im selben Zug hat das wieder aufgekommene Interesse an indigenen, nichtwestlichen und traditionellen Wissensformen ansprechende Alternativen zur Mainstream-Forschung und ihrer Suche nach mitunter wurzellos und amoralisch erscheinenden Wahrheiten hervorgebracht.
Für Wissenschaftshistoriker*innen bedeuten diese Entwicklungen eine gravierende Veränderung ihrer Forschungslandschaft. In der Vergangenheit konnten Wissenschaftler*innen weitgehend davon ausgehen, dass fachfremde Leser*innen und Studierende ihre Forschung als Quelle zuverlässiger, universeller Wahrheiten akzeptierten – und, dass daher der Wert ihrer Forschung darin lag, zu zeigen, wie diese Autorität historisch entstanden war und wie diese universellen Ansprüche in bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten begründet wurden. Von dieser Prämisse ist nicht mehr auszugehen. Heute stehen fachfremde Personen dem Nutzen und dem Wert der Wissenschaft häufig skeptischer gegenüber als die Forscher*innen selbst. Sie müssen nicht erst davon überzeugt werden, dass Wissenschaft situiert und nicht unbefangen ist und selbst wenn dem so wäre, hätten sie viele andere Ansprechpersonen, an die sie sich wenden könnten.
Historiker*innen haben auf diesen sich verändernden Forschungskontext unter anderem damit reagiert, dass sie historisch erklären, warum der Wissenschaft vertraut werden sollte und wie dieses Vertrauen möglicherweise gestärkt werden könnte. Dieser Wandel wirft jedoch auch weiter gefasste Fragen auf – Fragen, die nicht unmittelbar auf das Vertrauen abzielen, sondern vielmehr auf die Wechselverhältnisse, die verschiedene Wissenssysteme untereinander hervorgebracht haben und an deren Herausbildung sie aktiv beteiligt waren. Wie haben kollaborative Projekte der Wissensproduktion die Beziehungen der Menschen zueinander gestärkt? Wie haben Meinungsverschiedenheiten über Standards und Praktiken der Wissensproduktion Gemeinschaften gespalten? Und wie könnten die Beziehungen der Wissenschaft auf eine gerechtere und weniger aussichtslose Weise neugestaltet werden? Mit diesen Fragen im Fokus ist es das Forschungsziel der Abteilung, Wissenschaft als ein Wissenssystem zu verstehen, das die Beziehungen zwischen Individuen und Gemeinschaften auf verschiedenen Ebenen strukturiert hat, vom Labortisch bis hin zu Institutionen der Global Governance.